Thesen zu Imperialismus, Antiimperialismus und Internationalismus
Angesichts der globalen Zuspitzung von Konflikten gewinnen Diskussionen um Begriffe wie Imperialismus und Antiimperialismus immer mehr an Relevanz. Oft wird „antiimperialistisch“ hierbei als identitärer Marker genutzt, den man nimmt oder ablehnt.
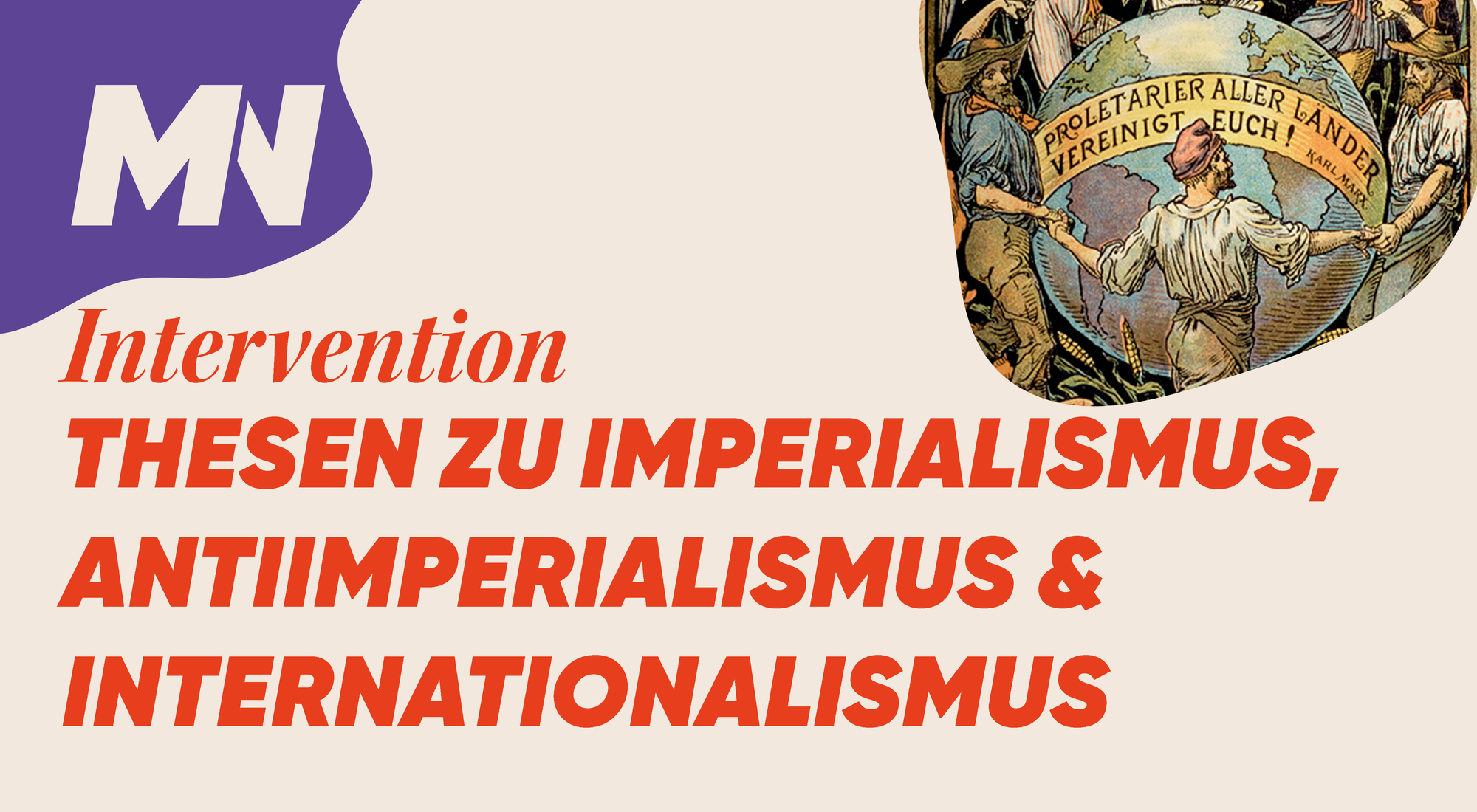
Annäherung
- Angesichts der globalen Zuspitzung von Konflikten gewinnen Diskussionen um Begriffe wie Imperialismus und Antiimperialismus immer mehr an Relevanz. Oft wird „antiimperialistisch“ hierbei als identitärer Marker genutzt, den man nimmt oder ablehnt. Eine präzise Bestimmung, was genau Imperialismus ist und wie genau er sich zum Kapitalismus verhält und, daraus folgend, was genau Antiimperialismus ist und wie genau er sich zu Klassenkämpfen und linker Politik im Allgemeinen verhält, fehlt dabei meistens.
- Wir verstehen Imperialismus als ein politisches Phänomen, das nicht alleine aus ökonomischen Prozessen abgeleitet werden kann. Imperialismus beschreibt Staatshandeln, bei dem ein Nationalstaat seine Macht nutzt, Herrschaft über eine andere Bevölkerung, ein fremdes Gebiets oder einen anderen Staat auszuüben. Da Imperialismus staatliches Handeln ist, muss eine Erklärung des Imperialismus auf materialistische Staatstheorie zurückgreifen, anstatt ihn unmittelbar aus der Expansionstendenz des Kapitals zu erklären. Der Expansionsdrang des Kapitals (bspw. in Form des Kapitalexports) ist ein zentraler, schon von Anfang an gegebener Aspekt des Kapitalismus. Der Imperialismus zeichnet sich dadurch aus, dass sich bei ihm diese Expansion des Kapitalismus auf die militärischen und politischen Potenziale von Staaten stützt, anstatt nur durch Investitionen zu geschehen.
- Der Kapitalismus zeichnet sich durch das Staatensystem der kapitalistischen Staatenkonkurrenz aus. Die Vielstaatlichkeit ist ein festes Strukturmerkmal des Kapitalismus, da durch die Konkurrenz zwischen den Einzelstaaten stabilere Reproduktionsbedingungen für das Kapital garantiert sind – gäbe es einen Weltstaat, könnte dieser Steuern erhöhen, Märkte regulieren oder gar enteignen wie er will. Durch die Staatenkonkurrenz um Investitionen und Kapital sind diese Handlungsmöglichkeiten begrenzt, weshalb das Kapital ein prinzipielles Interesse an Vielstaatlichkeit hat. Dabei haben verschiedene Nationalstaaten unterschiedlich viele Machtmittel ökonomischer, militärischer und politischer Natur. Es gibt also keine einfache Zweiteilung in imperialistische und nicht-imperialistische Staaten, sondern eine globale Hierarchie der Staaten im Verhältnis zueinander. Da der Kapitalismus eine ungleiche Verfügungsgewalt über Reichtum zur Voraussetzung hat und diese aufrecht erhält und da militärische und politische Macht nicht völlig unabhängig von wirtschaftlicher Macht denkbar sind, ist auch diese Staatenhierarchie ein Strukturmerkmal des Kapitalismus, was sich nur durch ein Ende des Kapitalismus überwinden lässt.
- Aufgabe einer linken Imperialismustheorie ist es, das Phänomen Imperialismus zu erklären, seine ideologischen Rechtfertigungen zu entlarven und Strategien zur Überwindung imperialistischer Herrschaft zu entwickeln.
Eine materialistische Staatstheorie
- Die globale Hierarchie zwischen Nationalstaaten ist nicht naturgegeben, sondern dynamisch. Ernst gemeinter Antiimperialismus kann also nicht einzelne Nationalstaaten als überhistorisch unterdrückerische oder unterdrückte Staaten identifizieren, während Nationalismen – auch die derzeit unterdrückter Nationen – das nahezu immer tun und ihrer Nation eine überhistorische Essenz andichten. Eine unkritische Identifikation von Antiimperialismus mit derzeit unterdrückten Nationalismen geht also fehl.
- Nationalstaaten sind erst einige hundert Jahre alt und aus einer spezifischen historischen Situation entstanden. Durch die Etablierung von stehenden Heeren als Standard der Kriegführung war es notwendig, von komplizierten, kleinstaatlich-feudalen Zuständen mit Doppel- bis Vielfachherrschaft verschiedener Feudalherren, der katholischen Kirche usw. zu größeren Flächenstaaten mit größerer Kontrolle über ihr Territorium überzugehen – kennzeichnend dafür war der absolutistische Staat in der frühen Neuzeit. Dadurch haben sich klare Staatsgrenzen, wie wir sie heute kennen, erst etabliert. Um ein starkes Militär sicherzustellen, brauchte der Staat ein sicheres Einkommen, beispielsweise durch Steuereinnahmen. Um diese sicherzustellen, muss ein Staat als ideeller Gesamtkapitalist dafür sorgen, dass innerhalb seiner Grenzen möglichst viel Mehrwert abgeschöpft werden kann. Die militärische Macht von Staaten wurde also immer mehr von deren ökonomischer Leistungsfähigkeit abhängig, die wiederum aber auch von militärischer Macht abhängig war und ist: Sind Staaten nicht dazu in der Lage, ein starkes Militär aufzubauen und aufrechtzuerhalten oder sind sie abhängig von wichtigen Transportrouten, werden die Staaten, die diese Mittel kontrollieren, zum Hegemon.
- Obwohl europäische Nationalstaaten aus der zentralisierenden Dynamik des Feudalismus entstanden, unterscheidet sich kapitalistische Staatlichkeit von feudaler und absolutistischer in einem entscheidenden Punkt: Im Kapitalismus sind Politik und Ökonomie institutionell getrennt, während sie im Feudalismus zusammenhingen. Dieser Unterschied ist auf die Verallgemeinerung von Tauschbeziehungen im Übergang zum Kapitalismus zurückzuführen: Der leibeigene Bauer übte den unmittelbaren Besitz über seine agrarwirtschaftlichen Produktionsmittel aus. Die Aneignung des Mehrwerts durch den Ausbeuter musste daher zwangsläufig durch die Anwendung bzw. Androhung unmittelbarer Gewalt erfolgen. Der Ausbeuter – der Feudalherr – war daher zugleich auch Inhaber der Herrschaftsgewalt. Anders im Kapitalismus: Hier ist der Ausgebeutete besitzlos. Der Zwang zur Mehrarbeit für den Ausbeuter wird damit nicht durch unmittelbare Gewalt organisiert, sondern erfolgt „freiwillig“ durch die Handlungsalternativen zwischen dem Verkauf der Ware Arbeitskraft und Elend, die sich dem individuellen Lohnarbeiter stellen. Der Lohnarbeiter tritt dem Kapitalisten damit nicht als Untertan, sondern als freie und gleiche Rechtspersönlichkeit auf dem Markt gegenüber. Zugleich erfordert es die Arbeitsteilung, dass Kapitalist:innen untereinander in Tauschbeziehungen treten. Der Kapitalismus ist daher auf eine neutrale, allgemeine, „dritte“ Instanz angewiesen, die den freien und gleichen Äquivalententausch zwischen Warenbesitzer A und Warenbesitzer B in der Zirkulationssphäre garantiert, ohne den einen oder anderen Warenbesitzer zu bevorzugen. Diese Instanz ist der Staat mit seinem Gewaltmonopol, der die Form einer allgemeinen, subjektlosen Gewalt annimmt (im Gegensatz zur persönlichen, an einen Herrscher gebundenen Gewalt im Feudalismus und Absolutismus). Aufgrund dieser institutionellen Trennung zwischen Politik und Ökonomie weist der Staat im Kapitalismus eine relative Autonomie auf. Ein ökonomischer Determinismus, der das Handeln des Staates unmittelbar aus den Interessen der Kapitalist:innenklasse ableiten möchte, geht damit fehl.
- Die Herausbildung handlungsfähiger Flächenstaaten war die Situation, in der die Ideologie des Nationalismus entstand. An dieser Stelle ist festzuhalten, dass Klassen, nicht Nationen, Geschichte machende Akteure sind. Nationalismus hingegen behauptet eine Schicksalsgemeinschaft einer Bevölkerung auf einem geographischen Gebiet, die unterschiedlichen Klassen angehört. Da Klassen unterschiedliche Interessen haben, Nationalismus aber eine Identität von Interessen behauptet, ist der Nationalismus damit tendenziell eine Legitimationsideologie für die Herrschaft einer Klasse über eine andere. Gleichzeitig hat der Nationalismus aber einen Doppelcharakter, da er neben der Legitimationsfunktion auch eine Integrationsfunktion hat. Soll heißen: Gerade weil er die (gleichwohl nur formale) Gleichheit aller Staatsbürger:innen behauptet, untergrub der Nationalismus die alten ständischen Privilegien. Die Entstehung von Nationalstaaten hing damit auch mit der Entstehung von Konzepten wie Bürgerrechten, des allgemeinen Wahlrechts etc. zusammen. Insbesondere im Kontext antikolonialer Befreiungskämpfe ist Nationalismus oftmals ideologischer Ausdruck eines Bündnisses verschiedener Klassen, deren materielle Interessen sich überlappen. Das gemeinsame Interesse dieser Klassen besteht in der Gegnerschaft zur Herrschaft einer ausländischen Macht und/oder Kompradorenbourgeoisie, von der man sich durch Klassenkampf befreien möchte. In einer in Nationalstaaten organisierten Welt wäre es daher falsch, nationale Befreiungsbewegungen einfach abzukanzeln und die Relevanz des Kampfes gegen nationale Unterdrückung zu leugnen. Gleichzeitig ist ein unkritischer Bezug auf nationale Befreiung, erst Recht eine Konzipierung von nationalen Befreiungskämpfen als quasi schon sozialistisch, eine Sackgasse, da Nationalismus immer auch eine ausgrenzende und Herrschaft stützende Dimension hat. In der teilweise unkritischen Verklärung von Befreiungsnationalismen durch manche Linke drückt sich ein Mangel an fundierter Staatskritik und ein oberflächliches Verständnis des Kapitalismus als globaler Ordnung aus; in dem Desinteresse anderer Linker gegenüber real existierender nationaler Unterdrückung intellektuelle Arroganz.
Antiimperialismus und Internationalismus are not the same?
- Der Expansionsdrang des Kapitals ist ein zentraler, schon von Anfang an gegebener Aspekt des Kapitalismus. Aus der Expansionstendenz des Kapitals ergibt sich eine globale Arbeitsteilung mit Lieferketten, die den ganzen Globus umspannen. Darüber hinaus erlaubt es die oben beschriebene Vielstaatlichkeit im Kapitalismus den Kapitalist:innen Produktionsstandorte ins Ausland zu verlagern und damit Belegschaften unterschiedlicher Standorte gegeneinander auszuspielen und so gewerkschaftliche Kämpfe wirksam zu unterdrücken. Um dem international agierenden Kapital effektiv gegenübertreten zu können, braucht es gemeinsame Kämpfe der weltweiten Arbeiter:innenklasse. Auch, um im Rahmen der kapitalistischen Staatenkonkurrenz eine lebensfähige sozialistische Gesellschaft aufzubauen, braucht es eine sozialistische Umgestaltung durch die Arbeiter:innenklasse, die einzelne Staaten übersteigt. Diese gemeinsamen Kämpfe der Arbeiter:innenklasse weltweit nennen wir Internationalismus.
- Antiimperialismus hängt mit Internationalismus zusammen, ist aber nicht das Gleiche und kann unter Umständen auseinanderfallen: Die Ablehnung von Imperialismus aus einer linken Perspektive ergibt sich aus der normativen Haltung gegen Unterdrückung, nicht aus der strategischen Notwendigkeit von internationaler Solidarität. Während Internationalismus also den Zusammenschluss mit Gleichgesinnten fordert, lehnt Antiimperialismus auch imperialistische Politik ab, die Staaten trifft, mit denen man erst einmal nicht sympathisiert. Während Internationalismus auf die aktive Stärkung von Verbündeten in anderen Teilen der Welt abzielt, ist das Ziel von Antiimperialismus stattdessen die Unterlassung vom Einsatz staatlicher Gewaltmittel gegenüber anderen Nationalstaaten.
- Weil Antiimperialismus bloß die Gegnerschaft zu einem imperialistischen Projekt beschreibt, muss dieser nicht notwendigerweise eine emanzipatorische Stoßrichtung annehmen. Er kann auch verschiedensten Herrschaftsinteressen dienen. Fremde imperialistische Herrschaft wird in diesen Fällen nicht kritisiert, weil man Herrschaft, Ausbeutung und Unterdrückung grundsätzlich ablehnt, sondern weil sie das eigene Herrschaftsinteresse einschränkt. Antiimperialismus kann daher sogar als rhetorische Legitimationsideologie alternativer imperialer Projekte auftreten. Deshalb kann Antiimperialismus auch von religiös-fundamentalistischen, faschistischen und reaktionär-nationalistischen Kräften vertreten werden.
- Campismus ordnet imperialistische Politik nur bestimmten Nationen oder Bündnissen zu. Er befürwortet Handeln, das von imperialistischen Akteuren gegen andere imperialistische Akteure gerichtet ist, ohne die ebenfalls imperialistische Motivation eben dieses Handelns zu bemerken. Der imperialistische Charakter kann dabei, je nach Zuordnung zu einem Lager, sowohl beim eigenen als auch bei fremden Imperialismen ausgeblendet werden. Das kann dazu führen, die staatliches Handeln legitimierenden Ideologien der eigenen oder einer anderen Gruppe von Nationen zu übernehmen und sich damit zum Fürsprecher von Nationalismen zu machen. Für Linke, die sich nicht mit der Funktionsweise von Imperialismus auseinandergesetzt haben, sondern nur aus Ablehnung imperialistischer Politik eigener oder verbündeter Staaten handeln, wird dieser daher attraktiv.
- Da antiimperialistische Politik für uns in Deutschland darauf abzielt, Handlungen des eigenen Staates oder verbündeter Staaten zu verhindern, ist ihre Voraussetzung der Aufbau einer starken, handlungsfähigen Arbeiter:innenbewegung im eigenen Land.

